

 Der Hochfreie Leopold von Projern scheint 1106 als Liupold de Prewarin in einer Urkunde des Salzburger Erzbischofs Konrad als Zeuge auf. Vermutlich war es sein Sohn Karl, der im zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts am höchsten Punkt einer Bergkuppe unterhalb des Ulrichsberges einen Wehrbau errichten ließ. Er wird als Namensgeber von Burg und Schloss betrachtet. Seine Familie nannte sich nun „von Karlsberg“. Wie sein Vater war er ein Ministeriale des Erzbischofs von Salzburg, doch trat er bald in die Dienste der Spanheimer ein, bei denen seine Nachkommen ab 1245 als Marschälle für die Pferde und Stallungen der Kärntner Herzoge verantwortlich waren. Wolflinus von Karlsberg war ein Bruder des Marschalls Heinrich II. Er beteiligte sich an einer Verschwörung des Grafen von Heunburg gegen die Grafen von Görz-Tirol, die damals die Kärntner Landesfürsten waren. Nach der Niederschlagung des Aufstandes, bei der die Burg schwere Schäden erlitt, wurde Wolflinus gemeinsam mit Konrad von Freiberg am Marktplatz von St. Veit hingerichtet. Heinrich II verlor die Marschallswürde und seine Burg, obwohl er an der Verschwörung gar nicht beteiligt war. Er musste 1295 Kärnten verlassen. Sein Nachfolger im Amt und als Burgherr wurde 1294 Konrad von Aufenstein, ein treuer Parteigänger des Herzogs Meinhardt von Kärnten. Allerdings musste er die schwer beschädigte Burg weitgehend erneuern. Er ließ den Turm zum mächtigen Bergfried ausbauen und aufstocken, der heute noch als Ruine erhalten ist.
Der Hochfreie Leopold von Projern scheint 1106 als Liupold de Prewarin in einer Urkunde des Salzburger Erzbischofs Konrad als Zeuge auf. Vermutlich war es sein Sohn Karl, der im zweiten Viertel des 12. Jahrhunderts am höchsten Punkt einer Bergkuppe unterhalb des Ulrichsberges einen Wehrbau errichten ließ. Er wird als Namensgeber von Burg und Schloss betrachtet. Seine Familie nannte sich nun „von Karlsberg“. Wie sein Vater war er ein Ministeriale des Erzbischofs von Salzburg, doch trat er bald in die Dienste der Spanheimer ein, bei denen seine Nachkommen ab 1245 als Marschälle für die Pferde und Stallungen der Kärntner Herzoge verantwortlich waren. Wolflinus von Karlsberg war ein Bruder des Marschalls Heinrich II. Er beteiligte sich an einer Verschwörung des Grafen von Heunburg gegen die Grafen von Görz-Tirol, die damals die Kärntner Landesfürsten waren. Nach der Niederschlagung des Aufstandes, bei der die Burg schwere Schäden erlitt, wurde Wolflinus gemeinsam mit Konrad von Freiberg am Marktplatz von St. Veit hingerichtet. Heinrich II verlor die Marschallswürde und seine Burg, obwohl er an der Verschwörung gar nicht beteiligt war. Er musste 1295 Kärnten verlassen. Sein Nachfolger im Amt und als Burgherr wurde 1294 Konrad von Aufenstein, ein treuer Parteigänger des Herzogs Meinhardt von Kärnten. Allerdings musste er die schwer beschädigte Burg weitgehend erneuern. Er ließ den Turm zum mächtigen Bergfried ausbauen und aufstocken, der heute noch als Ruine erhalten ist.
 Aber auch die Aufensteiner beteiligten sich 1368 an einer Verschwörung, worauf sie Karlsberg verloren. Die Burg wurde in den damit verbundenen Kämpfen neuerlich schwer beschädigt aber bald wieder aufgebaut. Karlsberg wurde von den Habsburgern nicht mehr als Lehen vergeben. Es blieb 200 Jahre lang landesfürstlich und wurde von Pflegern betreut, diente aber auch mehrfach als Pfandobjekt. Zu den Pfandherren des 15. Jahrhunderts gehörten u. a. Jakob von Ernau (1466), Berthold Mager (1470) und Jörg Waldenburger (1499). 1550 verpfändete König Ferdinand I die Burg dem Vicedom Siegmund Khevenhüller. Erzherzog Karl von Innerösterreich verkaufte sie schließlich 1586 an Siegmunds Sohn Georg. Als Protestanten mussten die Khevenhüller 1629 das Land verlassen. Da Paul Khevenhüller im 30-jährigen Krieg mit den Schweden gegen die Habsburger kämpfte, ging Karlsberg für die Familie Khevenhüller endgültig verloren. Die Herrschaft wurde an den bambergische Vicedom in Kärnten und späteren Bischof von Bamberg Franz Freiherr von Hatzfeld verkauft. Danach wird Karl-Rudolf Freiherr von Wangler (1633 - 1667) als Inhaber der Herrschaft genannt. Seine Tochter Sidonia Regina, die mit Jakob-Ludwig Graf Windischgrätz verheiratet war, verkaufte sie 1687 dem Gurker Bischof Kardinal Johann Freiherr von Goess. Nach dessen Tod erbten seine beiden Neffen sein Vermögen.
Aber auch die Aufensteiner beteiligten sich 1368 an einer Verschwörung, worauf sie Karlsberg verloren. Die Burg wurde in den damit verbundenen Kämpfen neuerlich schwer beschädigt aber bald wieder aufgebaut. Karlsberg wurde von den Habsburgern nicht mehr als Lehen vergeben. Es blieb 200 Jahre lang landesfürstlich und wurde von Pflegern betreut, diente aber auch mehrfach als Pfandobjekt. Zu den Pfandherren des 15. Jahrhunderts gehörten u. a. Jakob von Ernau (1466), Berthold Mager (1470) und Jörg Waldenburger (1499). 1550 verpfändete König Ferdinand I die Burg dem Vicedom Siegmund Khevenhüller. Erzherzog Karl von Innerösterreich verkaufte sie schließlich 1586 an Siegmunds Sohn Georg. Als Protestanten mussten die Khevenhüller 1629 das Land verlassen. Da Paul Khevenhüller im 30-jährigen Krieg mit den Schweden gegen die Habsburger kämpfte, ging Karlsberg für die Familie Khevenhüller endgültig verloren. Die Herrschaft wurde an den bambergische Vicedom in Kärnten und späteren Bischof von Bamberg Franz Freiherr von Hatzfeld verkauft. Danach wird Karl-Rudolf Freiherr von Wangler (1633 - 1667) als Inhaber der Herrschaft genannt. Seine Tochter Sidonia Regina, die mit Jakob-Ludwig Graf Windischgrätz verheiratet war, verkaufte sie 1687 dem Gurker Bischof Kardinal Johann Freiherr von Goess. Nach dessen Tod erbten seine beiden Neffen sein Vermögen.
 Die Ruine ist heute von dichten Wäldern umgeben. Sie liegt in beherrschender Lage auf einem Grat zwischen dem Zollfeld und dem Glantal. Während der Blütezeit der Burg Karlsberg konnte man von ihr aus zwei Täler kontrollieren. Von der einstigen Zwillingsburg sind nur mehr wenige Mauerreste zu sehen. Am besten erhalten ist eine Ecke des einst fünfgeschossigen romanischen Bergfriedes, der noch vor 1688 wegen Baufälligkeit gesprengt werden musste. An der Basis hat der Turmstumpf eine Mauerstärke von mehr als drei Meter. Seine Kanten waren mit Marmorquadern verstärkt. Das Innere bildet ein Quadrat von ca. 6,5 m Seitenlänge. Nach dem Verfall des Bergfrieds wurde aus ihm der frühgotische Giebel eines romanischen Doppelfensters entfernt und in die Gartenmauer des Schlosses eingesetzt. Er zeigt in vereinfachter Form einen Uhu (oder Auf), das Wappentier der Aufensteiner. Vom Palas ist nichts mehr vorhanden. Teile der Seitenmauern sowie Reste der Apsis erinnern an die romanische Burgkapelle. Der Schutt der zerfallenen Ringmauern und die dazwischen liegenden Halsgräben sind heute mit dichtem Bewuchs bedeckt. Lediglich ein ehemaliger dreigeschossiger Wachturm ist im Norden noch als solcher zu erkennen.
Die Ruine ist heute von dichten Wäldern umgeben. Sie liegt in beherrschender Lage auf einem Grat zwischen dem Zollfeld und dem Glantal. Während der Blütezeit der Burg Karlsberg konnte man von ihr aus zwei Täler kontrollieren. Von der einstigen Zwillingsburg sind nur mehr wenige Mauerreste zu sehen. Am besten erhalten ist eine Ecke des einst fünfgeschossigen romanischen Bergfriedes, der noch vor 1688 wegen Baufälligkeit gesprengt werden musste. An der Basis hat der Turmstumpf eine Mauerstärke von mehr als drei Meter. Seine Kanten waren mit Marmorquadern verstärkt. Das Innere bildet ein Quadrat von ca. 6,5 m Seitenlänge. Nach dem Verfall des Bergfrieds wurde aus ihm der frühgotische Giebel eines romanischen Doppelfensters entfernt und in die Gartenmauer des Schlosses eingesetzt. Er zeigt in vereinfachter Form einen Uhu (oder Auf), das Wappentier der Aufensteiner. Vom Palas ist nichts mehr vorhanden. Teile der Seitenmauern sowie Reste der Apsis erinnern an die romanische Burgkapelle. Der Schutt der zerfallenen Ringmauern und die dazwischen liegenden Halsgräben sind heute mit dichtem Bewuchs bedeckt. Lediglich ein ehemaliger dreigeschossiger Wachturm ist im Norden noch als solcher zu erkennen.
 Nachdem die am Hügel gelegene Burg ihre militärische Bedeutung verloren hatte und die Eigentümer mehr Wert auf Komfort und Wohnlichkeit legten, wurde sie von ihren Bewohnern verlassen und geriet in Verfall. Hingegen wurde der auf einem kleinen Plateau unterhalb der Ruine liegende Meierhof vermutlich durch Karl-Rudolf Freiherr von Wangler schlossartig ausgebaut. Die Khevenhüller schufen einen Vierflügelbau, der im 17. Jahrhundert seine heutige zweigeschossige Form erhielt, im 19. Jahrhundert aber überarbeitet wurde. 1728 wurde die Anlage im Auftrag von Johann Graf Goess an der Südostecke durch den Anbau der dem hl. Karl Borromäus geweihten Schlosskapelle erweitert. Ihr barocker Dachreiter mit Uhr, Haube und Laterne gibt der ansonsten einfachen, aber hübschen Hauptfront ein charakteristisches Aussehen. Der von Johann Graf Goess gestiftete Schnitzaltar zeigt das Bild des hl. Borromäus. Auch das Oratorium ist mit Schnitzereien verziert. Zwei geschnitzte Engel halten das Doppelwappen des Kardinals Johann Freiherr von Goess. In der Sakristei steht ein Schrank mit bemalten Flügeln vom Ende des 17. Jahrhunderts. Die Schauseite des Schlosses ist siebenachsig. Ein barockes Einfahrtstor ist mittig angeordnet. Es führt in den rechteckigen Schlosshof. Über dem korbbogigen Tor wurde ein großes Doppelwappen der Familien Goess-Sinzendorf von 1697 angebracht. Die Fenster des Obergeschosses sind mit Läden und geraden Verdachungen versehen. An der Südseite verläuft ein hölzerner offener Gang. An seiner Wand sind zwei aus der Zeit der Aufensteiner stammende Gedenksteine und zwei Römersteine eingemauert. Sie wurden aus der bereits verfallenen Burg hierher gebracht. Die Jahreszahl 1315 auf einem Inschriftstein weist auf die Bauarbeiten an der Burg unter Konrad von Aufenstein hin. Auch ein aus dem Schloss Hunnenbrunn stammender marmorner Wandbrunnen mit dem Khevenhüllerwappen von 1585 befindet sich seit 1948 hier. Die gepflegten Wohnräume liegen im Obergeschoß. Das Schloss wird von Mitgliedern der Familie Goess, denen auch das Waldgebiet mit der Ruine gehört, bewohnt.
Nachdem die am Hügel gelegene Burg ihre militärische Bedeutung verloren hatte und die Eigentümer mehr Wert auf Komfort und Wohnlichkeit legten, wurde sie von ihren Bewohnern verlassen und geriet in Verfall. Hingegen wurde der auf einem kleinen Plateau unterhalb der Ruine liegende Meierhof vermutlich durch Karl-Rudolf Freiherr von Wangler schlossartig ausgebaut. Die Khevenhüller schufen einen Vierflügelbau, der im 17. Jahrhundert seine heutige zweigeschossige Form erhielt, im 19. Jahrhundert aber überarbeitet wurde. 1728 wurde die Anlage im Auftrag von Johann Graf Goess an der Südostecke durch den Anbau der dem hl. Karl Borromäus geweihten Schlosskapelle erweitert. Ihr barocker Dachreiter mit Uhr, Haube und Laterne gibt der ansonsten einfachen, aber hübschen Hauptfront ein charakteristisches Aussehen. Der von Johann Graf Goess gestiftete Schnitzaltar zeigt das Bild des hl. Borromäus. Auch das Oratorium ist mit Schnitzereien verziert. Zwei geschnitzte Engel halten das Doppelwappen des Kardinals Johann Freiherr von Goess. In der Sakristei steht ein Schrank mit bemalten Flügeln vom Ende des 17. Jahrhunderts. Die Schauseite des Schlosses ist siebenachsig. Ein barockes Einfahrtstor ist mittig angeordnet. Es führt in den rechteckigen Schlosshof. Über dem korbbogigen Tor wurde ein großes Doppelwappen der Familien Goess-Sinzendorf von 1697 angebracht. Die Fenster des Obergeschosses sind mit Läden und geraden Verdachungen versehen. An der Südseite verläuft ein hölzerner offener Gang. An seiner Wand sind zwei aus der Zeit der Aufensteiner stammende Gedenksteine und zwei Römersteine eingemauert. Sie wurden aus der bereits verfallenen Burg hierher gebracht. Die Jahreszahl 1315 auf einem Inschriftstein weist auf die Bauarbeiten an der Burg unter Konrad von Aufenstein hin. Auch ein aus dem Schloss Hunnenbrunn stammender marmorner Wandbrunnen mit dem Khevenhüllerwappen von 1585 befindet sich seit 1948 hier. Die gepflegten Wohnräume liegen im Obergeschoß. Das Schloss wird von Mitgliedern der Familie Goess, denen auch das Waldgebiet mit der Ruine gehört, bewohnt.
Lage: Glantal, unweit von Projern
Besichtigung: nicht möglich
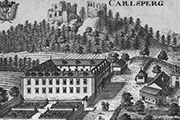 Weitere Literatur:
Weitere Literatur:
20.10.2014